
Arm und hochbegabt – ohne Privilegien eh keine Chance
Christine gehört zu den rund zwei Prozent der Menschheit, deren IQ über 130 liegt. Was nach Spitzenleistungen, Wunderkind und einer steilen Karriere klingt, endete in Leistungsdruck und Einsamkeit. Hat das Konzept der Hochbegabung mit seinem klassistischen Gefälle ausgedient?
„Ich habe schon in sehr jungen Jahren darauf gedrängt, unbedingt in die Schule zu gehen.“ Christine* (*Name geändert) besuchte erst ein Jahr lang den Kindergarten, als sie begann, sich zu langweilen. Sie konnte längst lesen und schreiben, als sie mit fünf Jahren endlich eingeschult wurde. Doch auch in der ersten Klasse fühlte sie sich schnell unterfordert. Ein Intelligenztest sollte Klarheit bringen. An die Aufgaben erinnert sich Christine heute kaum, lediglich an das Ergebnis: hochbegabt.
„Hochbegabte können schnell und sehr effektiv Neuinformationen aufnehmen und verarbeiten“, sagt Dr. Thomas Dreisörner. Er lehrt pädagogische Psychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und ist fachlicher Leiter der Beratungsstelle MAINKIND für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, ADHS und Hochbegabung. „Die Denkgeschwindigkeit ist bei diesen Kindern in der Regel höher. Zudem zeigen sie schon recht früh sogenannte Abstraktions- und Übertragungsleistungen. Sie machen also eine Erfahrung und können sie auf andere Bereiche transferieren.“ All das trifft auf Christine zu und so sprang sie nach einem halben Jahr in der ersten Klasse in die zweite.

Schulen wie das Landesgymnasium für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd fördern gezielt hochbegabte Schüler. Bild: Martin Christ
Strategien zur Förderung Hochbegabter
Akzeleration nennt sich diese Methode zur Förderung Hochbegabter: Sie durchlaufen die Schule schneller als andere, werden vorzeitig eingeschult oder überspringen eine Klasse. Der Prozess sollte gut vorbereitet sein, betont Dreisörner. „Die aufnehmende Klassenlehrerin sollte der Maßnahme gegenüber positiv eingestellt sein. Zudem muss der Schulstoff des übersprungenen Jahres nachgeholt werden. Die Frage ist: Wer kümmert sich darum? Schaffen das die Eltern oder brauchen sie Unterstützung? Wenn diese Bedingungen für das Überspringen nicht gegeben sind, ist es besser, darauf zu verzichten“, sagt der Psychotherapeut. Dann sollten Betroffene stattdessen auf das sogenannte „Enrichment“ setzen: Die Methode fördert Hochbegabte mithilfe individueller Aufgabenstellungen oder zusätzlicher Kurse.
Häufig kommt es zu einer Kombination von Enrichment und Akzeleration. So auch bei Christine: Kurze Zeit nach ihrem Start in der zweiten Klasse besuchte sie Kurse an der Volkshochschule. In einem Chemieseminar experimentierte sie, ein anderes Mal lernte sie Ägypten spielerisch kennen und baute ein Modell des nahöstlichen Staats. Endlich fühlte sie sich angekommen, genoss die Schule und hatte Spaß am Lernen. Ihre vergangene Langeweile entpuppte sich als Wissbegierde. In der höheren Klassenstufe fiel ihre Hochbegabung bald kaum mehr auf, bis es zum ersten Schulwechsel kam.

Dr. Thomas Dreisörner lehrt pädagogische Psychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und ist fachlicher Leiter der Beratungsstelle MAINKIND für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, ADHS und Hochbegabung. Bild: Thomas Dreisöner
Einsamkeit im schulischen Alltag
„Ich hatte häufig den Hochbegabtenstempel drauf und manchmal das Gefühl, dass mich andere hauptsächlich dadurch definierten und nicht durch andere Interessen oder Talente. Dadurch lastete ein gewisser Erfolgs- und Leistungsdruck auf mir, weil ich ja immer ‚die Hochbegabte‘ war“, sagt Christine. Ihr selbst waren ihre Noten zunächst gar nicht so wichtig. Oftmals strengte sie sich nicht sonderlich an, ihr fehlte die Motivation. Sie wollte nicht unbedingt die Beste sein. Zudem wusste sie, dass sie ohne große Mühen mittelmäßig bis gut abschneiden würde.
Die zwei Jahre Altersunterschied, die sie und ihre Klassenkamerad*innen voneinander trennten, machten sich spätestens in der Pubertät bemerkbar – anders als ihr Intellekt hinkte Christines physische Entwicklung hinterher. „Ich würde zwar sagen, dass ich relativ angepasst und reifer als Gleichaltrige war, aber man hat den Altersunterschied trotzdem bemerkt“, sagt sie. „Das war nicht immer einfach. Gerade in der Pubertät strebt man ja häufig danach, dazuzugehören und sich anzupassen. Und das geht schlecht, wenn so ein offensichtlicher Unterschied da ist, an dem ich nichts ändern konnte.“
Christine gehörte zu den Jahrgängen, die statt dreizehn Schuljahren nur zwölf absolvierten. Mit 16 begann sie ein Mathematikstudium. Mal wieder war sie die Jüngste. Und nach wenigen Monaten musste sie feststellen: Mathe war nicht das, was sie wollte. Die Erkenntnis fiel ihr schwer, schließlich war sie bekannt für ihr Mathetalent. Nach zwei Semestern wechselte sie zu Publizistik. Weitere 18 Monate später brach sie auch ihr zweites Studium ab. „Ich wusste gar nicht wirklich, was ich machen wollte. Lange Zeit war mein Selbstbild stark von außen geprägt. Das Mathestudium hat einfach zu dem Bild gepasst, was andere von mir hatten. Ich habe dann versucht, diesem Bild zu entsprechen.“ Nach dem erneuten Abbruch ließ sich Christine Zeit, um endlich herauszufinden, wer sie wirklich ist. „Ich musste mich erst mal von den Erwartungen anderer frei machen und mich kennenlernen – abseits von Leistungen und dem Ganzen.“ In diesem Jahr möchte Christine eine Ausbildung zur Kauffrau im E-Commerce beginnen.

Viele Hochbegabte leidern unter Einsamkeit im schulischen Alltag. So auch Christine, deren Selbstbild lange von Außen geprägt war. Bild: Annie Spratt
Die Erfindung der Intelligenz
Vom Lateinischen intellegere abgeleitet, was erkennen, einsehen oder verstehen bedeutet, etablierte sich der Begriff der Intelligenz ab dem frühen 20. Jahrhundert. Er umschreibt die kognitive Leistungsfähigkeit. Der französische Psychologe Alfred Binet begründete damals das Gebiet der Psychometrie, das psychische Phänomene messbar machen sollte. Im Rahmen dessen entwickelte er zusammen mit dem französischen Psychologen Théodore Simon den ersten Intelligenztest für Kinder.
Das Konzept einer messbaren Intelligenz war seit jeher kritischen Stimmen ausgesetzt – Kritiker*innen halten es für unmöglich, das individuelle innere Erleben zu beziffern. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu stuft die Erfindung des Intelligenztests zudem als klassistisch ein. In Soziale Fragen führt er jene Erfindung auf die eingeführte Schulpflicht zurück, die Lehrkräfte plötzlich mit Schüler*innen ohne Bildungshintergrund konfrontierte, „mit denen dieses Schulsystem nichts anzufangen wusste, weil sie […] nicht von ihrem familiären Milieu her mit jenen Prädispositionen ausgestattet [waren], die die Voraussetzung für das normale Funktionieren des Schulsystems sind: Kulturelles Kapital und guter Wille in Bezug auf die Schulabschlüsse.“

Der französische Psychologe Alfred Binet begründete das Gebiet der Psychometrie, das psychische Phänomene messbar machen sollte. Im Rahmen dessen entwickelte er zusammen mit dem französischen Psychologen Théodore Simon den ersten Intelligenztest für Kinder. Bild: Fotograf unidentifiziert
Der marxistische Publizist Freerk Huisken geht noch weiter und zweifelt das Konzept der Intelligenz als solches an. In Die Wissenschaft von der Erziehung schreibt er: „Jeder wie immer gearteten Leistung soll eine Potenz zugrunde liegen, die alles möglich macht, indem sie nichts Bestimmtes enthält […]. Und das ist absurd. Denn [es] wird nicht behauptet, diese Potenz erspare einem die Aneignung irgendeiner Kenntnis. […] Aber kaum ist [die Kenntnis] erarbeitet, soll [sie] nicht auf diese Tätigkeit des Geistes zurückgehen.“ Stattdessen wird sie auf die vermeintlich zugrunde liegende Intelligenz zurückgeführt.
Trotz aller Kritik schritt die Forschung zur Intelligenz voran. Der deutsche Psychologe William Stern prägte 1912 den Begriff des Intelligenzquotienten. Einige Jahre später begann in den Vereinigten Staaten eine Langzeitstudie, die etwa 1500 hochbegabte Kinder und Jugendliche beobachtete und Schlüsse über ihren sozioökonomischen Status zog. Die Studie wurde von Kritiker*innen mehrfach aufgrund der vermeintlich unsauberen Arbeitsweise und der eugenischen Ideologie des US-amerikanischen Psychologen Lewis Terman, der sie durchführte, diskreditiert. Die Lehre der Eugenik strebte seit dem 19. Jahrhundert danach, vermeintlich positive Erbanlagen des Menschen zu vermehren. Doch Intelligenzforschung und Eugenik waren auch jenseits der Terman-Studie eng verwoben: Im Rahmen des zutiefst verwerflichen Bestrebens nach einer sogenannten „Rassenhygiene“ wurden Intelligenztests unter anderem im Dritten Reich genutzt, um vermeintlich „schwachsinnige“ Personen zu identifizieren. Damit sich diese nicht weiter fortpflanzen konnten, wurden sie zwangssterilisiert oder ermordet.
Obgleich es sich hier um einen desaströsen Missbrauch des Intelligenztests handelt, stellt sich dennoch die Frage: Was, wenn nicht eben diese dezidierte Trennung zwischen intelligenteren und weniger intelligenteren Personen, möchte ein Test bewirken, der auf einer skalierten Rangordnung der intellektuellen Fähigkeiten beruht?
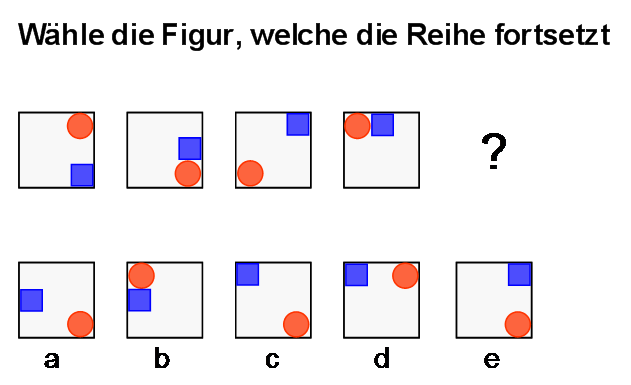
Das Konzept einer messbaren Intelligenz war schon immer umstritten – Kritiker*innen halten es für unmöglich, das individuelle innere Erleben zu beziffern. Grafik: Nesbit
Hochbegabung: Ein Phänomen der gebildeten Oberschicht?
Hochbegabung basiert auf einer genetischen Veranlagung. Mit der richtigen Förderung können solche Begabungen wachsen und gedeihen. Doch auch die Einflüsse, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, spielen eine wichtige Rolle. „Eltern, die selbst einen entsprechenden Bildungshintergrund haben, können solche Kinder besser fördern. Das sind zusätzliche Aspekte, die dazu führen können, dass eine Hochbegabung sich überhaupt entsprechend entfalten kann“, sagt Dreisörner.
Wenn er von den begünstigenden Faktoren einer Hochbegabung spricht, wird ihr klassistisches Fundament, das schon Bourdieu kritisierte, deutlich: Kinder aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen können auf ihre genetische Veranlagung unter Umständen gar nicht zugreifen. „Wer musikalisch sehr begabt ist, aber nie mit einer Geige in Berührung kommt, wird nicht Geige spielen lernen. Und das gilt eben auch für das Thema Begabung“, sagt der psychologische Psychotherapeut. „Oft braucht intellektuelle Leistung ein gewisses Umfeld, um sich zu entfalten.“ Doch das können womöglich weder die Eltern noch Lehrkräfte oder andere Bezugspersonen ermöglichen.
Auch in der kritisierten Langzeitstudie aus dem Jahr 1928 von Terman zu Hochbegabung dominiert das Bild vom hochbegabten Kind aus sozioökonomisch erfolgreichen Herkunftsfamilien. Hochbegabte Kinder jener Familien profitieren vom ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapital ihrer Eltern und bringen es schließlich mithilfe dessen auch im beruflichen Kontext weiter. Das liegt laut der Terman-Studie an motivationalen Faktoren, die solche Kinder erlernen. Das ökonomische Kapital spielt wohl zudem eine schwerwiegende Rolle. Schließlich hängt Intelligenz auch unter einem IQ von 130 mit dem sozioökonomischen Umfeld zusammen. Egal wie die Veranlagung aussieht, am Ende leidet die Intelligenz unter einem materiellen und sozialen Mangel.
Eine Studie der Vanderbilt University in den Vereinigten Staaten von 2019 bestätigt den Einfluss des sozioökonomischen Hintergrunds auf hochbegabte Kinder und ihre schulische Laufbahn. Demnach ist es für Schüler*innen aus Familien mit dem höchsten sozioökonomischen Status sechsmal wahrscheinlicher, in einem Hochbegabtenkurs zu landen als für ihre Mitschüler*innen aus Familien mit dem niedrigsten sozioökonomischen Status. Selbst wenn Schüler*innen die gleichen Leistungen erbringen, sind sie seltener in solchen Kursen zu finden, wenn sie einen entsprechend niedrigen sozioökonomischen Hintergrund vorweisen. Das liegt daran, dass die Begabung von Kindern und Jugendlichen aus solchen Herkunftsfamilien häufig nicht identifiziert wird. Oftmals gehen das besondere Talent und die resultierende Unterforderung von solchen Schüler*innen gar als Verhaltensauffälligkeit unter.

Für Schüler*innen aus Familien mit dem höchsten sozioökonomischen Status ist sechsmal wahrscheinlicher, in einem Hochbegabtenkurs zu landen als für ihre Mitschüler*innen aus Familien mit dem niedrigsten sozioökonomischen Status, so eine amerikanische Studie. Bild: Jerry Wang
Hochbegabung in anderen Kulturen – wo wird‘s richtig gemacht?
Der Blick auf andere Kulturen und Länder zeigt: Hochbegabung funktioniert mehr oder weniger überall gleich. Der Intelligenzquotient liefert die Indikation für eine Hochbegabung, Akzeleration und Enrichment sind die Fördermethoden der Wahl, (private) Schulen für Hochbegabte bieten eine isolierte Alternative. Abweichungen treten höchstens im Niveau der Methoden auf – manche Länder sind besser auf Hochbegabte vorbereitet, andere weniger gut.
Japan ist so ein Land der letzteren Sorte. Hier spricht man von den vergessenen Hochbegabten, es gibt keine Fördermethoden an Schulen. Doch Japan nimmt sein Problem in Angriff: In den nächsten Jahren möchte das Land an dem Entwurf eines einheitlichen Förderprogramms für hochbegabte Kinder arbeiten.
Die Vereinigten Staaten fangen hochbegabte Schüler*innen mit ihren extracurricular activities und Summer Schools relativ gut auf. Doch Native Americans werden dabei häufig übersehen. Die grundlegende Benachteiligung der indigenen Völker schlägt sich auch in der Identifikation Hochbegabter nieder. Hier tut sich ein weiterer Kritikpunkt am Konzept der Hochbegabung auf: Die Intelligenz ethnischer Minderheiten und Personen nicht-westlicher Kulturkreise könne mit einem klassischen Intelligenztest nicht gemessen werden. Das liegt daran, dass verschiedene Kulturen häufig eine andere Vorstellung von Intelligenz haben – sie priorisieren andere Qualitäten und Fähigkeiten.
Anders als mit den Native Americans in den Vereinigten Staaten verhält es sich mit den Māori, der indigenen Bevölkerung Neuseelands. Denn in dem pazifischen Inselstaat beinhaltet der Begabungsbegriff über die klassischen Kategorien hinaus auch kulturell spezifische Fähigkeiten der Māori. So streben einige Schulen danach, besonders ausgeprägte Qualitäten der indigenen Kultur wie etwa Großzügigkeit und familiäre Werte ebenso zu identifizieren wie eine klassische Begabung in Mathematik – ein Ansatz, der die gleichberechtigte Bildung innerhalb der beiden Kulturen stärkt.
Hat der Begriff Hochbegabung ausgedient?
Die Benachteiligung kultureller Minderheiten und sozioökonomisch unterprivilegierter Kinder macht deutlich: Die Identifikation und isolierte Förderung Hochbegabter bekräftigt die tiefen Gräben zwischen Kindern mit sozioökonomisch stärkerem und schwächerem Status und manifestiert eine Bildungsungleichheit, die es abzuschaffen gilt. Mit seinem eugenischen Hintergrund, den berechtigten Zweifeln an einer Messbarkeit der Intelligenz und den klassistischen Strukturen hat der Begriff der Hochbegabung ausgedient. Auch Begriffsalternativen wie Talent oder Genie ziehen eine Grenze zwischen all jenen, die durchschnittlich intelligent sind und all jenen, deren IQ eine schier willkürliche Barriere übersteigt.
Christines Geschichte unterstreicht die Einsamkeit, die aus einer solchen Grenze entstehen kann. Die Methode der Akzeleration war ihrem Lernfortschritt und ihrer Förderung dienlich, doch sozial siebten ihr Sonderstatus und der Altersunterschied sie aus. Statt der Akzeleration hätte Christine wohl auch ein Enrichment innerhalb des Klassenzimmers geholfen – das fand jedoch primär mithilfe externer Kurse statt. Würde ihre Ausbildung Lehrkräfte besser auf Hochbegabte und deren Bedürfnisse vorbereiten, so könnten sie Schüler*innen mit einer schnelleren Auffassungsgabe Seite an Seite mit solchen mit einem etwas langsameren Tempo fördern.
Danach strebt auch das Modern Classrooms Project aus den Vereinigten Staaten. Das Projekt bezieht sich auf eine Vielzahl von Studien, die das individuelle Lerntempo verschiedener Schüler*innen attestieren. Mithilfe des sogenannten Self-Pacing möchten die Beteiligten Kinder jeden Lerntempos auffangen und unterstützen. Ihre Herangehensweise basiert lose auf der Montessoripädagogik, die dafür plädiert, dass Kinder selbst das Tempo und die Themen ihres Unterrichtsstoffs wählen sollten. Das Modern Classrooms Project bildet dagegen Lehrkräfte aus, die sich an die Themen des jeweiligen Lehrplans halten, doch die Schüler*innen bearbeiten sie in ihrem eigenen Tempo.
Eine Themeneinheit teilt sich auf eine festgelegte Zahl von Unterrichtsstunden auf, während dieser die Schüler*innen sich den Unterrichtsstoff in ihrer eigenen Geschwindigkeit aneignen. Das Projekt hat mit seinen Online-Kursen bereits über 33 000 Lehrkräfte in über 150 Ländern erreicht. Diese setzen das Gelernte häufig mithilfe digitaler Technologien um: Sie nehmen ihre Lektionen als Video auf, das sich die Schüler*innen während der Unterrichtsstunden auf Tablets oder Computern ansehen. So schreitet ein Kind mit schnellem Lerntempo im Stoff bereits fort, während sich andere Schüler*innen Zeit lassen und das Video gegebenenfalls mehrmals ansehen, bis sie es verstanden haben. Damit zu Ende der Themeneinheit trotzdem alle Schüler*innen mehr oder weniger auf dem gleichen Stand sind, kennzeichnen die Lehrkräfte besonders wichtige sowie weniger wichtige Lektionen. Wenn eine neue Themeneinheit beginnt, fangen alle Schüler*innen wieder bei null an.
Damit unser Schulsystem allen Schüler*innen unabhängig ihres sozioökonomischen oder kulturellen Hintergrunds gleichberechtigte Bildungschancen ermöglicht, sollte es in der Manier des Modern Classrooms Project auf die Förderung aller Schüler*innen setzen, ob schneller oder langsamer, unter- oder überfordert, sodass sich die Bildungsschere, die sich mit der gesonderten Förderung Hochbegabter weiter öffnet, langsam schließt. Und zukünftige Betroffene wie Christine ebenso wie Kinder mit einem IQ unter 130 fortan mit all ihren Stärken und Schwächen wahrgenommen und gefördert werden.
Mehr über den wahren Wert von Bildung schreiben wir in unserem Kompendium Bildung als Wertanlage.



























