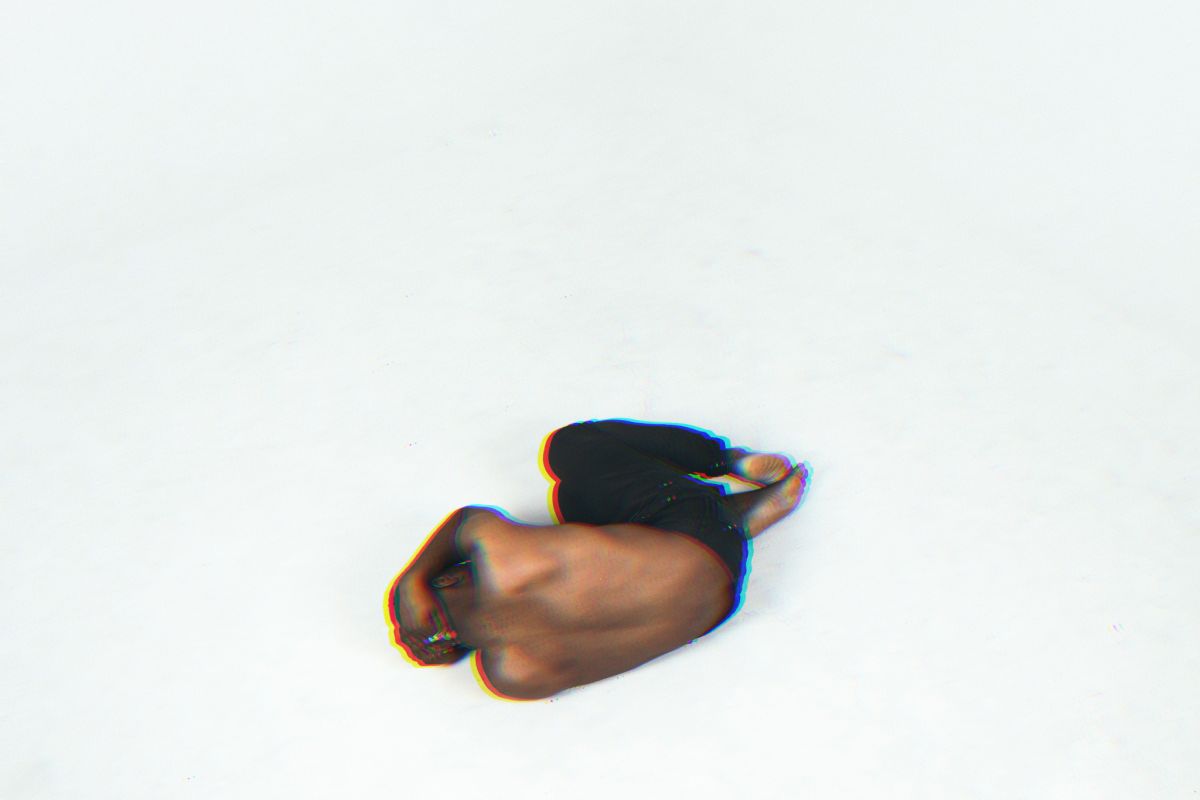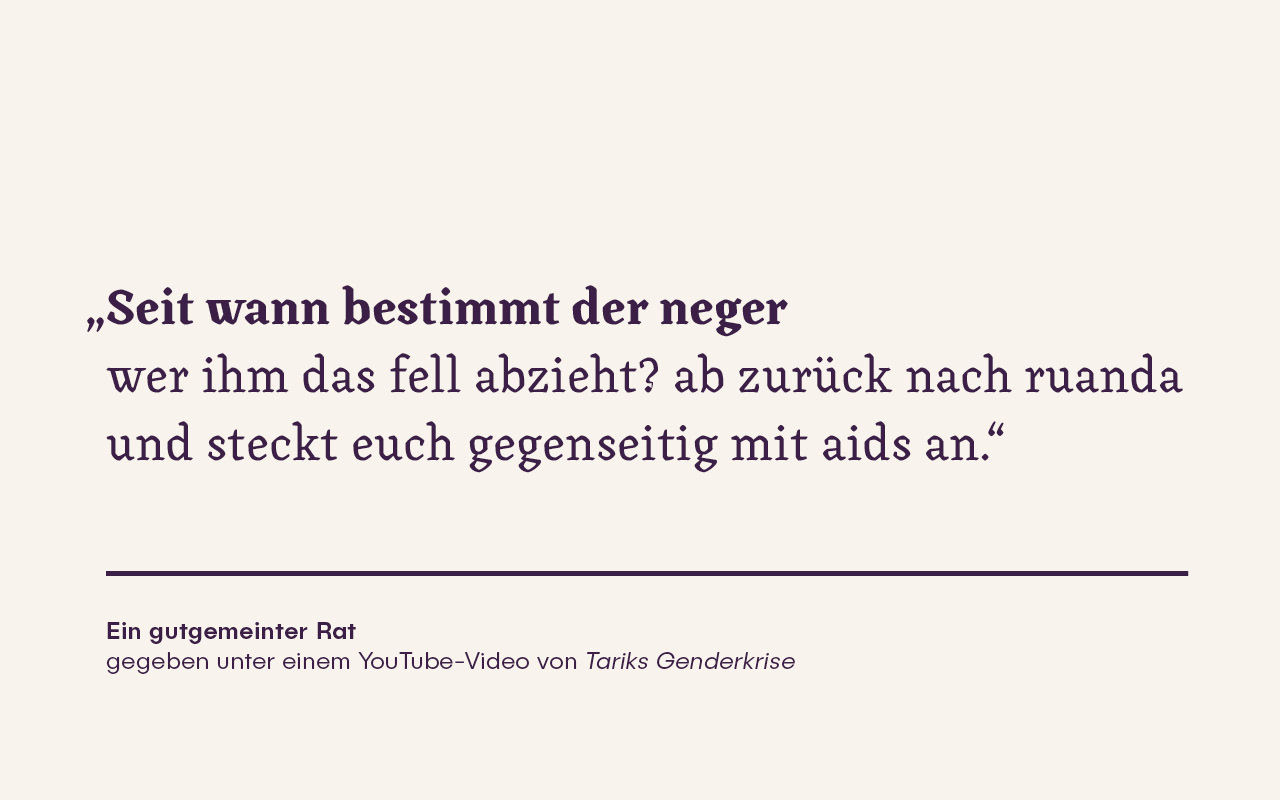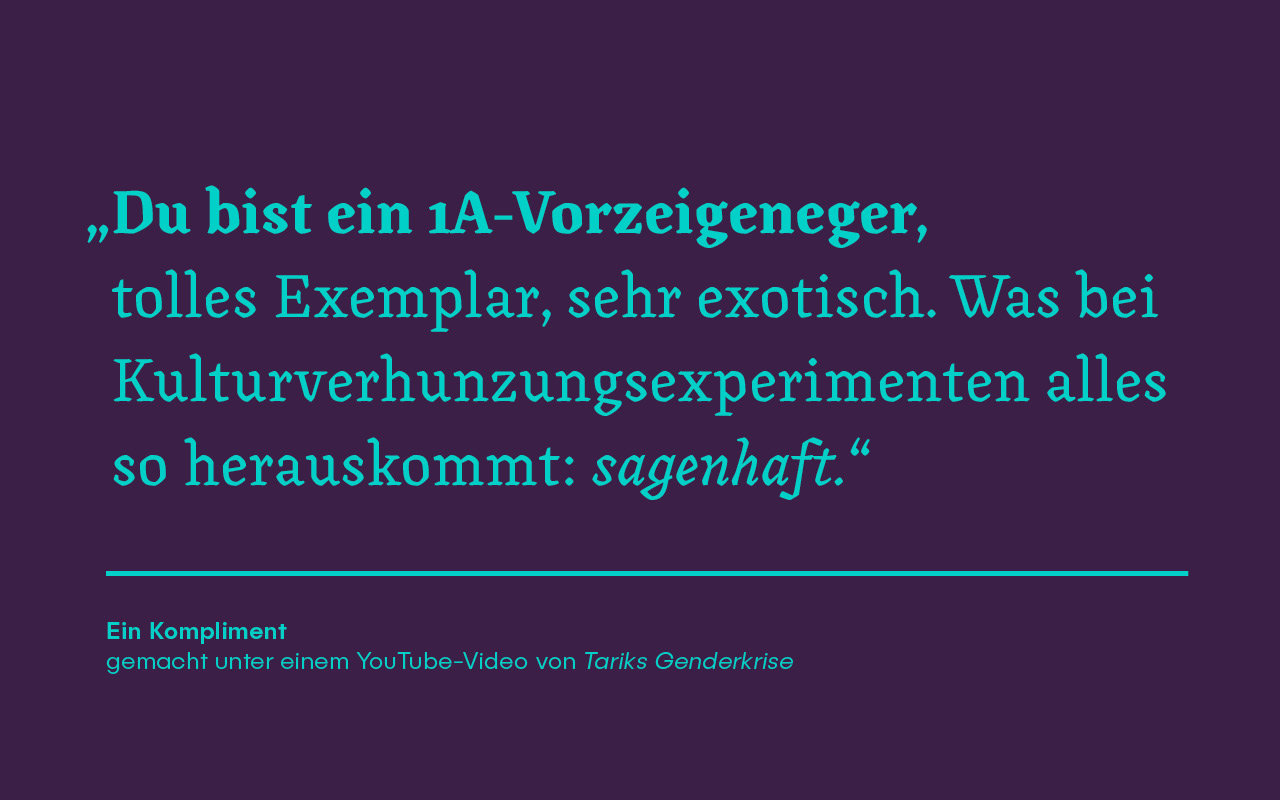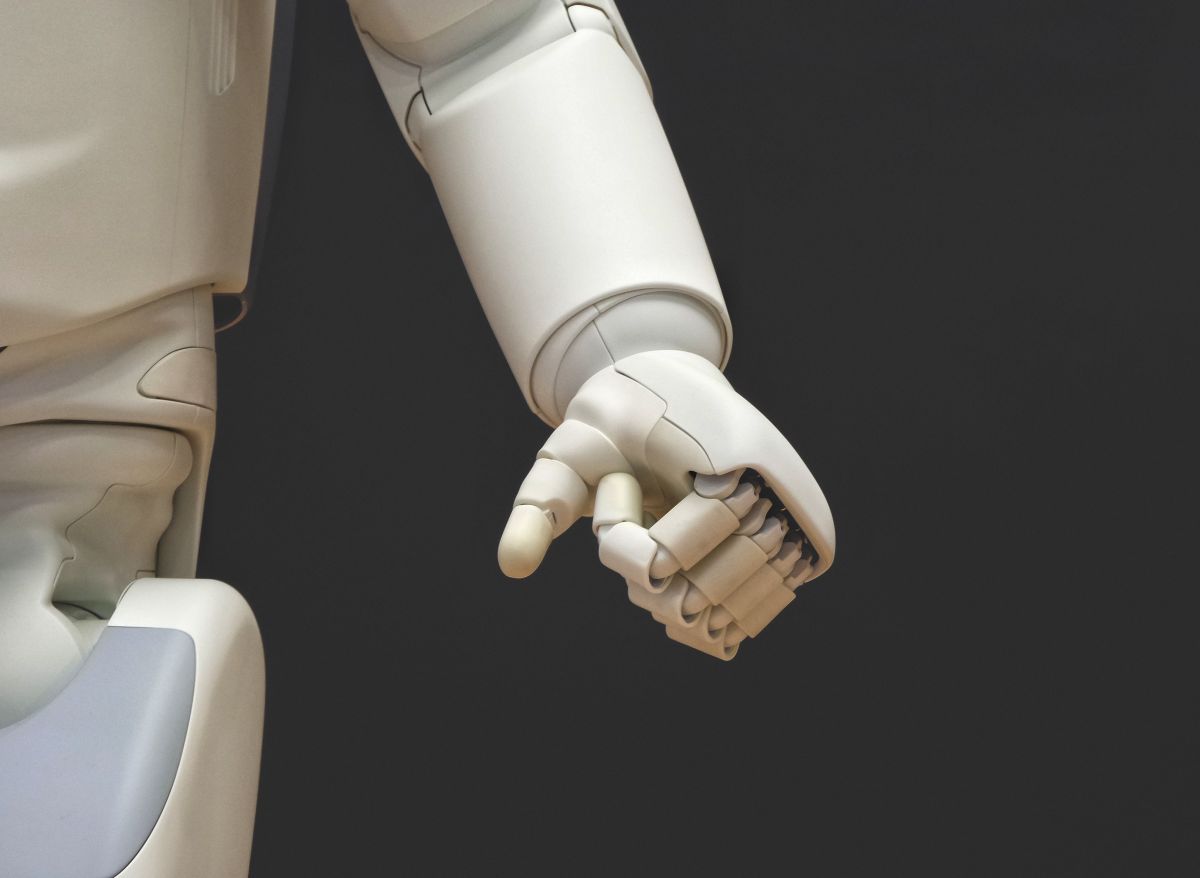Es erklärt sich von selbst, dass das Thema der virtuellen Gewalt, wie wir es im Jahr 2018 begreifen, in der griechischen Antike nicht relevant war. Aber schon damals war Darstellung von Gewalt zweckdienlich: Sie diente der Unterhaltung, Abschreckung oder Lehre. Wie bei der Geschichte zur Büchse der Pandora: dem Mythos darüber, wie das Böse in die Welt kam.
Von politischer Macht und dem gekränkten Ego
Als Reaktion auf das von Prometheus gestohlene Feuer ließ Zeus Pandora, die erste Frau, aus Lehm erschaffen. Sie wurde als Geschenk an Epimetheus überliefert – zusammen mit der Warnung, keine Gaben von Zeus anzunehmen. Aufgrund ihrer Schönheit und zahlreicher betörender Talente, kannte Epimetheus jedoch kein Halten und heiratete sie (dieser Lustmolch!). Dies war der perfekte Zeitpunkt für Pandora ihre kleine Büchse zu öffnen und all das Böse auf die Welt zu bringen. Als eine der ältesten Überlieferungen der griechischen Mythologie wurde nicht nur der Hass auf Frauen geschürt (thanks for that…), sondern, analog zum Sündenfall in der Bibel, auch davon erzählt, wie Krankheit, Gewalt, Leid und Tod über die Menschheit kam.
Einer der bekanntesten und einflussreichsten Belege für die Verbindung zwischen der Menschheit, den Medien und der Gewalt ist aber das Troja-Epos von Homer, eine der ersten fixierten Schriften der Menschheit. Selbst wenn umstritten ist, ob Homer der ursprüngliche Verfasser ist, wann genau das Werk niedergeschrieben wurde und wie viele historische Fakten wahrheitsgetreu festgehalten wurden, steht fest: Es ist ein Zeugnis brutaler Gewalt. Aufgeteilt in zwei Bücher, Ilias und Odyssee, wird aufgezeigt, wozu Menschen in diesem sagenumwobenen Krieg fähig waren: Grausamkeit, Schmerz und Leid, die Misshandlung von Fremden, Armen und Schwachen. Eindrucksvolle Blutbäder – alles unter dem Deckmantel des Ruhmes und der Ehre.

Pandora öffnet ihre Büchse und das Böse erobert die Welt. By Nicolas Régnier
Brutale Novellen als Entertainment
Auch Jahrhunderte später hat sich an dem Verhältnis zwischen Gewalt, Medien und Mensch nichts geändert, tatsächlich wurde es intensiviert. Mit der Erfindung und Verbreitung der von Johannes Gutenberg entwickelten Druckpresse, konnten schriftliche Medien in größerer Auflage vertrieben werden. Dank der Mechanisierung und der Massenproduktion am Fließband wurde das geschriebene Wort zu einem zugänglichen Kommunikationsmittel: Im späten 17. Jahrhundert waren autobiografische Novellen von amerikanischen Siedlern ein echter Hit. Sie enthielten oft sehr detailreiche Beschreibungen darüber, wie Siedler durch Native Americans massakriert wurden. Westworld lässt grüßen! Dies ist nur eines von vielen Beispielen, wie auch damals hasserfüllte politische Kämpfe über die Medien geführt wurden.
Abgesehen vom hetzerischen Inhalt dieser Geschichten wurde auch vom amerikanischen Präsidenten, dem Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, Thomas Jefferson, Kritik geübt. Seiner Meinung nach würden gewaltverherrlichende Bücher dazu führen, dass Leser einen verzerrten Blick auf die Realität bekämen und ihre Vorstellungskraft ausgereizt würde. Dies regte zukünftige Autorinnen und Autoren jedoch nicht dazu an, ihre Thematik zu überdenken. Schließlich ließ sich damit gut Geld verdienen: Im 18. und 19. Jahrhundert erfreuten sich Bücher, in denen es um die Verführung Minderjähriger, sexuellen Missbrauch und andere physische Gewalt ging, besonderer Beliebtheit.
Kann Gewalt schön sein?
Oder was ist es sonst, dass die Medien dazu bewegt, Gewalt darzustellen und Menschen dazu bringt, diese zu konsumieren? Als im 18. Jahrhundert der Schauerroman, die Gothic Novel, auf den Büchermarkt kommt, der darauf abzielt, Angst und Schrecken bei den Käuferinnen und Käufern auszulösen, wird klar: Dabei handelt es sich um ein Mittel der Unterhaltung. Der Autor, Philosoph und Politiker, Edmund Burke, befasste sich in seiner Untersuchung vom Erhabenen und Schönen im Jahr 1757 mit diesem Phänomen. Warum stellen literarische Medien Gewalt in dieser extremen Form dar? Er stellte die Theorie

Schon in den Sagen der Antike spielte Gewalt eine große Rolle. Auch in den folgenden Jahrhunderten werden detaillierte Darstellungen von blutrünstigen Kämpfen erzählt. By Jacques Réattu
auf, dass es in der Kunst nicht darum ginge, Schönheit zu zeigen, sondern etwas Erhabenes zu kreieren, das starke Gefühle auslöst. Und das stärkste Gefühl war seiner Meinung nach der Schmerz. Burke zufolge könnten Schmerz und Entsetzen ein angenehmes Gefühl beim Menschen auslösen: Erleichterung, da man selbst nicht die betroffene Person ist. Entspannung, sobald der Schrecken verdaut ist. Befriedigung, wenn ein einflussreicher Charakter besonders tief fällt.
In diesem Sinne kann man auch den Erfolg von Büchern wie Émile Zolas Die Bestie im Menschen aus dem 19. Jahrhundert erklären. Hier werden die tiefen Abgründe der menschlichen Existenz dargestellt – und trotzdem wird immer wieder auch Hoffnung beim Leser geweckt. So auch im Falle des Mythos der Pandora übrigens. Denn als Pandora ihre Büchse ein weiteres Mal öffnet, befreit sie damit die Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass im echten Leben vielleicht doch alles besser wird…