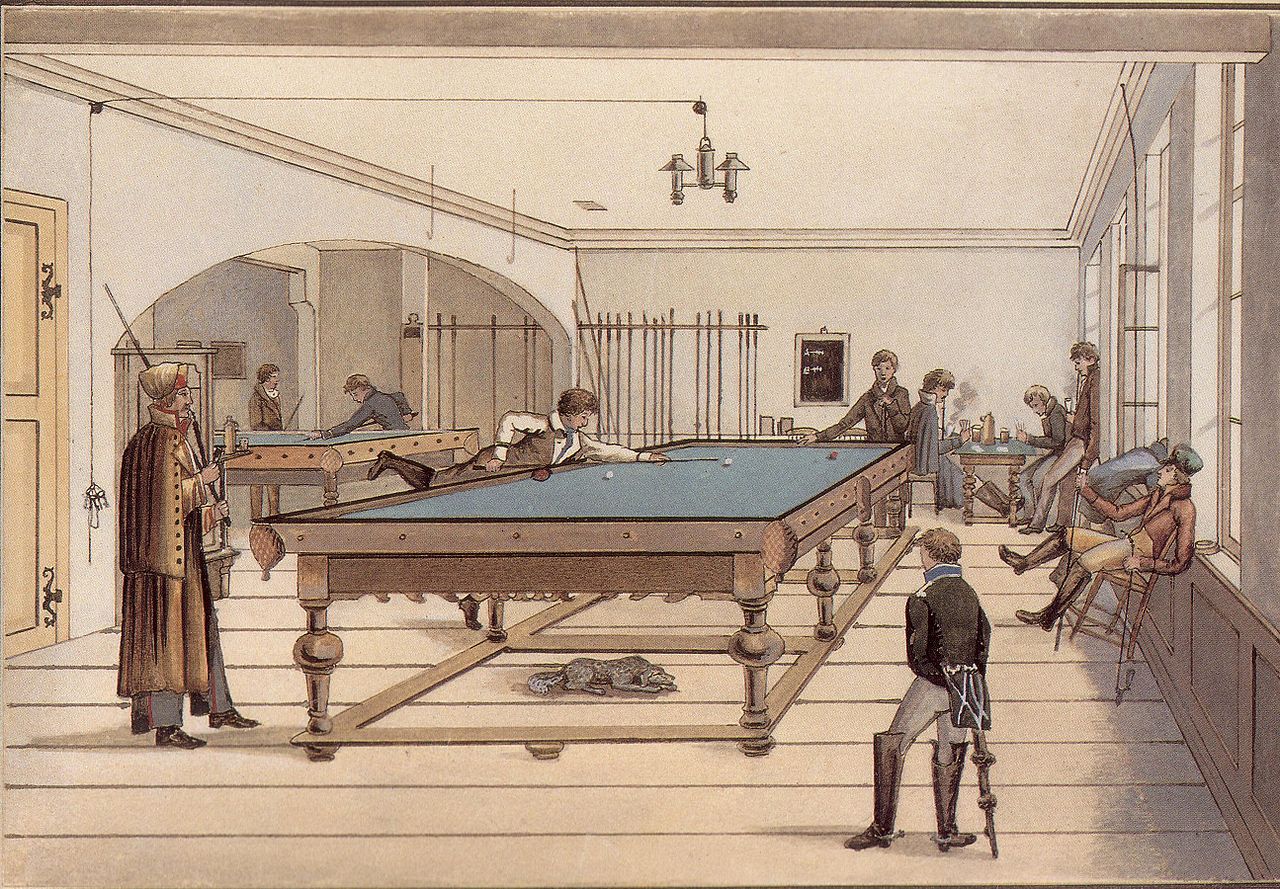Bereits in der Steinzeit sollen Jäger und Sammler einem spirituellen Glauben gefolgt sein, nämlich dem Animismus: Allen Naturerscheinungen wohnte demzufolge eine eigene Seel inne. Diese spirituelle Verbundenheit zeigte sich vor allem bei der Jagd, denn das Töten eines Tieres stand in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Glauben an eine höhere Instanz, die einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen sicherstellte. Etwas, woran auch heute noch indigene Völker festhalten.
Im 19. Jahrhundert beschäftigte sich der britische Anthropologe Edward Burnett Tylor mit der Entwicklung von Religionen. Seine damals radikale Theorie der soziokulturellen Evolution veröffentlichte er 1871. In ihr beschreibt Tylor den animistischen Glauben der Jäger und Sammler der Steinzeit an eine beseelte Natur. Diese animistische Primärreligion leitet sich vom Lateinischen animus ab, das für „Seele“ und „Geist“ steht.
Laut dem Animismus entspricht die spirituelle Welt auch der realen Welt. Anders ausgedrückt: Während wir heutzutage vor dem Schlafengehen eine halbe Stunde meditieren, um den Stress des Arbeitstages zu verarbeiten, gab es bei den Steinzeitvölkern keine Trennung von Alltag und Spiritualität. Durch die Allbeseeltheit natürlicher Dinge traf man den ganzen Tag auf einen Austausch zwischen den Welten. Auch und vor allem bei der Jagd.

Tiere zu jagen war notwendig, um zu überleben. Da man sich jedoch der Seele eines jeden Lebewesens bewusst war, schloss das Töten eben dieser auch bestimmte (Vergebungs-) Rituale mit ein. Foto: Pikist.
No prayers, no meat
Tiere zu jagen war notwendig, um zu überleben. Da man sich jedoch der Seele eines jeden Lebewesens bewusst war, schloss das Töten eben dieser auch bestimmte (Vergebungs-) Rituale mit ein. In der animistischen Primärreligion glaubte man an den „Herrn der Tiere“, dessen Segen für das eigene Jagdglück unabdingbar war. Neben Geschenken und Ritualen wie Beschwichtigungszeremonien war es in manchen Völkern auch üblich, dass ein lokaler Geisterbeschwörer Kontakt zum Tiergott aufnahm.
Spannend daran ist vor allem das Bewusstsein über die Endlichkeit von Ressourcen und der Respekt gegenüber dem Tier, denn die Völker hielten sich an die Regel, nur so viele Wildtiere zu jagen, wie absolut notwendig für die Gruppe waren. Der kollektive Besitz stand über dem eigenen. Wer gegen die Maßregelung verstieß, dem drohte eine Bestrafung von oben. Doch laut Tylor entwickelten animistisch geprägte Jäger und Sammler mit der Zeit den Glauben daran, selbst Einfluss auf die religiösen Gesetzmäßigkeiten nehmen zu können.
Höhlenmalereien und Fruchtbarkeitszauber
Der französische Archäologe Salomon Reinach und der Prähistoriker Henri Breuil verwiesen diesbezüglich auf das Mysterium der Höhlenmalereien, insbesondere auf den großen Anteil der Darstellungen einzelner Lebewesen ohne szenischen Kontext. Diese sollen ein Hinweis darauf sein, dass es weniger um künstlerische Abbildungen ging als vielmehr um die Einflussnahme auf bestimmte Tiere. Reinach und Breuil nannten diese Vorgehensweise den „Jagd- und Fruchtbarkeitszauber“. Die Zeichner*innen sollen daran festgehalten haben, durch die Darstellung einzelner Tiere deren Fruchtbarkeit und damit deren Bestand zu sichern. Eine direkte Kontaktaufnahme zum „Herrn der Tiere” oder der Glaube an eigene magische Kräfte? Das weiß niemand so genau.

Hier stehen Kühe in Massentierhaltung dicht gedrängt, während stählerne Vorrichtungen sie in der Position zum Fressen halten. Foto: Pxhere.
Von der spirituellen Jagd zur unreflektierten Massentierhaltung
Der Wunsch nach Einfluss und Kontrolle stellte damals noch keine Bedrohung für den Planeten dar. Die Jäger- und Sammlervölker der Steinzeit wussten, dass sie von einem guten Zusammenspiel mit der Natur abhängig waren. Sie suchten ihre Lösungen in der Spiritualität, denn die Ehrfurcht vor der Natur mit all ihren Geistern, die sie bewohnten, war groß.
Eine natürliche und nachhaltige Lebensweise wurde jedoch durch die Entwicklung moderner Gesellschaften vielerorts verdrängt. Die Menschen wurden sesshaft und wollten ihrem Essen wortwörtlich nicht mehr hinterherrennen. Für die meisten ist es heute selbstverständlich, dass Fleisch im Supermarkt immer verfügbar ist und es sich dabei um kein Luxusgut handelt – die Massentierhaltung macht die Maßlosigkeit des unreflektierten Konsums möglich.
Trotzdem leben auch heute noch abseits der Zivilisation indigene Völker auf den Spuren ihrer Vorfahren. Ihre Demut gegenüber der Natur sowie ihre nachhaltige Lebensweise könnte uns vor allem jetzt, in Zeiten der Klimakrise, Impulse, Inspiration und Wissen geben.