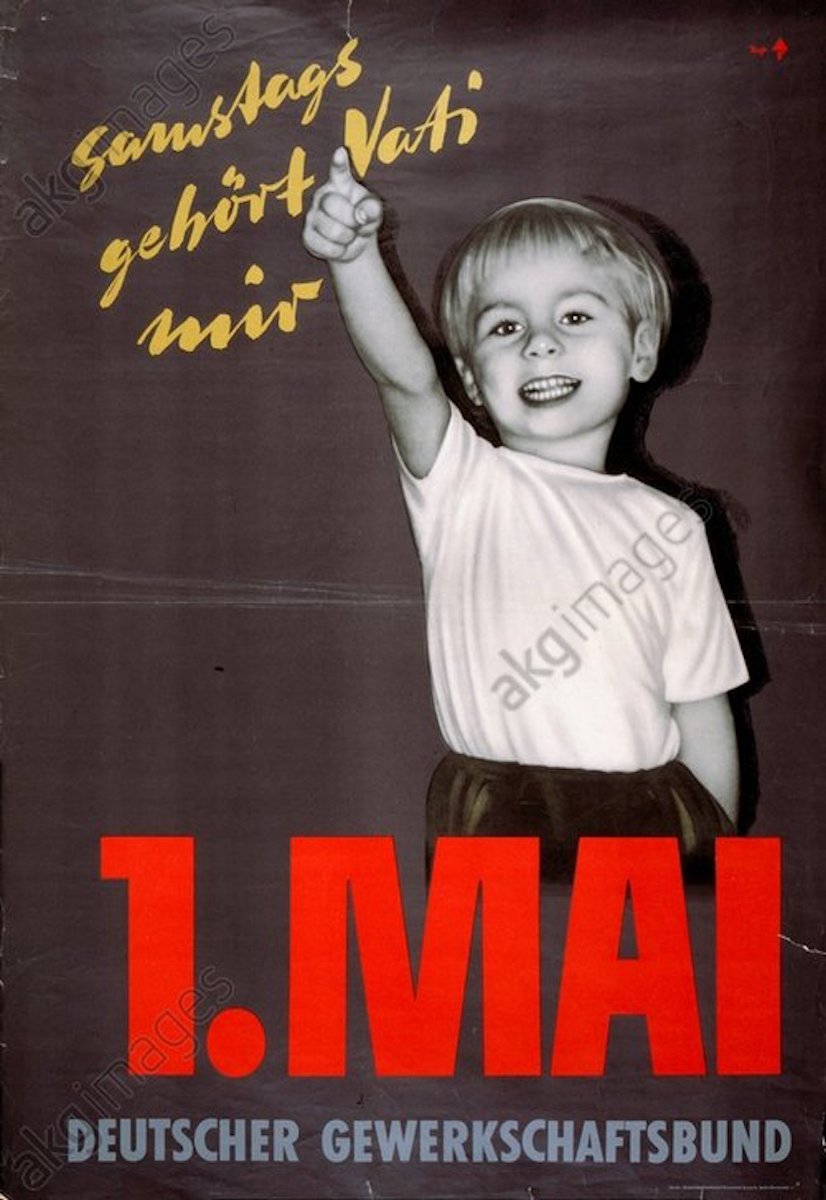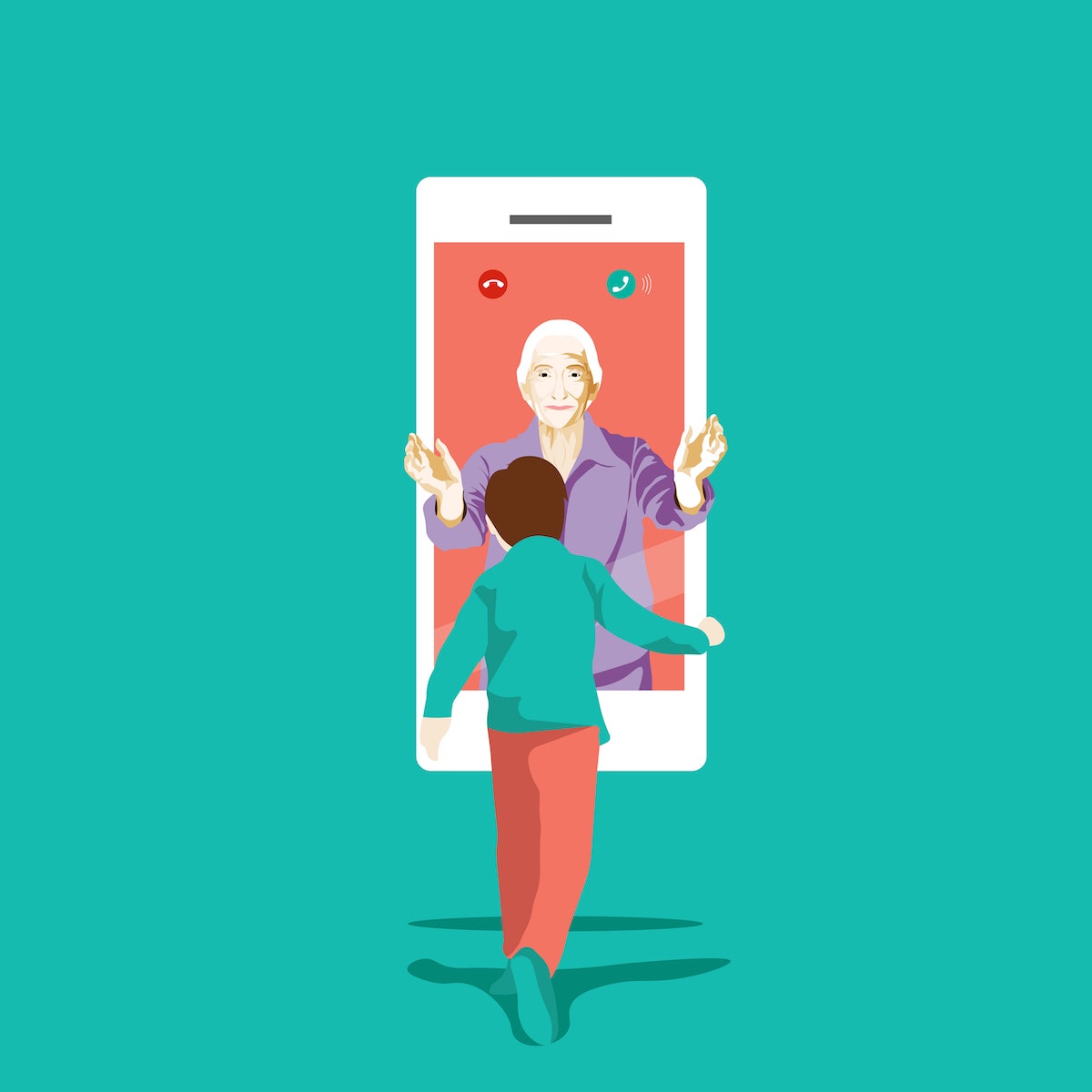Ein früher Streik für mehr Arbeiterrechte fand Mitte des 19. Jahrhunderts in Schlesien statt. Die Geschehnisse beschäftigten das kollektive Gedächtnis nachhaltig und flossen Jahrzehnte später in weitreichende Veränderungen ein.
„Halsabschneider!“, „Schurken!“, „Leuteschinder!“, rufen die aufgebrachten Peterswaldauer Weber am 4. Juni 1844, während sie durch das schlesische Dorf zum Haus des örtlichen Textilverlegers ziehen. Der Verleger – so hießen damals Textilkaufleute – liefert den Webern die Rohstoffe, aus denen sie in Heimarbeit Stoffe weben. Diese kauft er ihnen ab und verkauft sie anschließend weiter. Doch aufgrund von ausländischer Konkurrenz und der Industrialisierung ist der Preis für ihre Produkte in den Keller gefallen.
Auf dem Weg stimmen sie ein Lied an:
„Hier wird der Mensch langsam gequält, / hier ist die Folterkammer, / hier werden Seufzer viel gezählt / als Zeugen von dem Jammer. / Ihr Schurken all, ihr Satansbrut! / Ihr höllischen Cujone! / Ihr freßt der Armen Hab und Gut, / und Fluch wird euch zum Lohne!“
Die Weber haben Hunger und sind es leid, trotz ihrer harten Arbeit mit Hungerlöhnen und Hohn gedemütigt zu werden. Tagein, tagaus weben sie in Heimarbeit gegen neuartige Maschinen an, von denen eine einzige 100 von ihnen ersetzen kann. Sobald die Kinder der Weber mitarbeiten können, helfen sie ebenfalls. Doch auch das genügt nicht, um sich gegen die Konkurrenz aus dem Ausland und die Maschinen zu behaupten. Findet der Vorarbeiter des Verlegers den kleinsten Fehler in der Webarbeit, versucht er, den Preis derselben weiter zu drücken. Mütter müssen entscheiden, welche ihrer Kinder sie ernähren. Das Fass ist voll, die Weber fordern Gerechtigkeit.
Der Weberaufstand hinterlässt seine Spuren

Ein früher Streik für mehr Arbeiterrechte fand Mitte des 19. Jahrhunderts in Schlesien statt: die Weberaufstände. Skizze: Karikatur zum Schlesischen Weberaufstand in den 1840er Jahren, via Wikimedia Commons, gemeinfrei.
So kommt es in Peterswaldau und den umliegenden Gemeinden zu einer mehrtägigen Revolte, die zum Symbol für die Schattenseiten der Industrialisierung und des kapitalistischen Systems wird. Der Verleger und seine Familie können flüchten, doch das Haus wird verwüstet; in umliegenden Gemeinden trägt sich Ähnliches zu. Das herbeigerufene preußische Militär reagiert mit Gewalt und tötet insgesamt zehn Männer und eine Frau. Der Aufstand ist gescheitert, aber sein langfristiger Impact soll sich erst noch zeigen.
Zwar untersagt der preußische König der Presse, über den Vorfall zu berichten, doch das Thema beschäftigt die Gesellschaft weiterhin: Wie kann soziale Gerechtigkeit und Solidarität mit den Ärmsten aussehen? In der anschließenden Verhandlung zeigen sich die Richter verständnisvoll gegenüber den hungerleidenden Webern, sie führen in der Urteilsfindung die „drückende Not“ derselben als Milderungsgrund an, die Prozesskosten brummen sie den Gutsherren auf. Autoren wie Gerhart Hauptmann und Heinrich Heine verarbeiten die gescheiterten Weberaufstände in Literatur und Poesie. So tragen sie mit ihnen, wenn auch erst Jahrzehnte später, zu einer neuen gesellschaftlichen Idee bei: Solidarität.
Der Vormärz, also die Zeit zwischen 1830 und der Märzrevolution von 1848/49, beschert der entstehenden deutschen Gesellschaft neue Ideen wie Nationalismus, Liberalismus und Sozialismus. Es werden Arbeitervereine und Berufsverbände gegründet, die Druck auf die Arbeitgeber auszuüben vermögen und ihre Forderungen gesammelt artikulieren können. Arbeitskämpfe, Streiks und Boykotts werden zu den Werkzeugen dieser Bewegungen.
Streiks brauchen Solidarität, um zum Ziel zu führen

Die Weberaufstände zeigen: Ein Streik ohne weitreichende Solidarität ist „nur“ ein Aufstand, der niedergeschlagen werden kann. Presse und öffentliche Meinung sowie eine Regierung, die dem Volk Rechenschaft schuldig ist, sind notwendig, um politische Konsequenzen zu ermöglichen. Bild: Poster zur Bewerbung G. Hauptmanns Drama “Die Weber” von Emil Orlik, 1897, via Wikimedia Commons, gemeinfrei.
Die Weberaufstände zeigen: Ein Streik ohne weitreichende Solidarität ist „nur“ ein Aufstand, der niedergeschlagen werden kann. Presse und öffentliche Meinung sowie eine Regierung, die dem Volk Rechenschaft schuldig ist, sind notwendig, um politische Konsequenzen zu ermöglichen. Später ziehen gleich gesinnte Arbeiter Parallelen zu den schlesischen Webern, sodass sich eine immer stärker werdende politische Bewegung formiert. Auch wenn der Weberaufstand niedergeschlagen wurde, entwickelte er doch nachträglich Bedeutung für den Verlauf der Revolution 1848/49 und das Gemeinschaftsgefühl. Das Bürgertum wurde politisch aktiv und forderte die Gründung eines Nationalstaates mit Freiheits- und Grundrechten. Die fortschreitende Industrialisierung machte mehr und mehr Menschen zu Arbeitern, die unter ebenso prekären Umständen lebten wie die Weber. Menschen, die sich persönlich nicht kannten, verbrüderten sich für ein gemeinsames Ziel. In der Anzahl der Personen, die sich zusammenschließen, liegt Stärke. Diese Erkenntnis bildete schließlich die Grundlage für die Gründung von Gewerkschaften. Eine neue Idee war geboren: die Solidarität.